WS 2024 Freistadt
Lehmzunge
Stefan Nikolas Schenkel Naranjo.
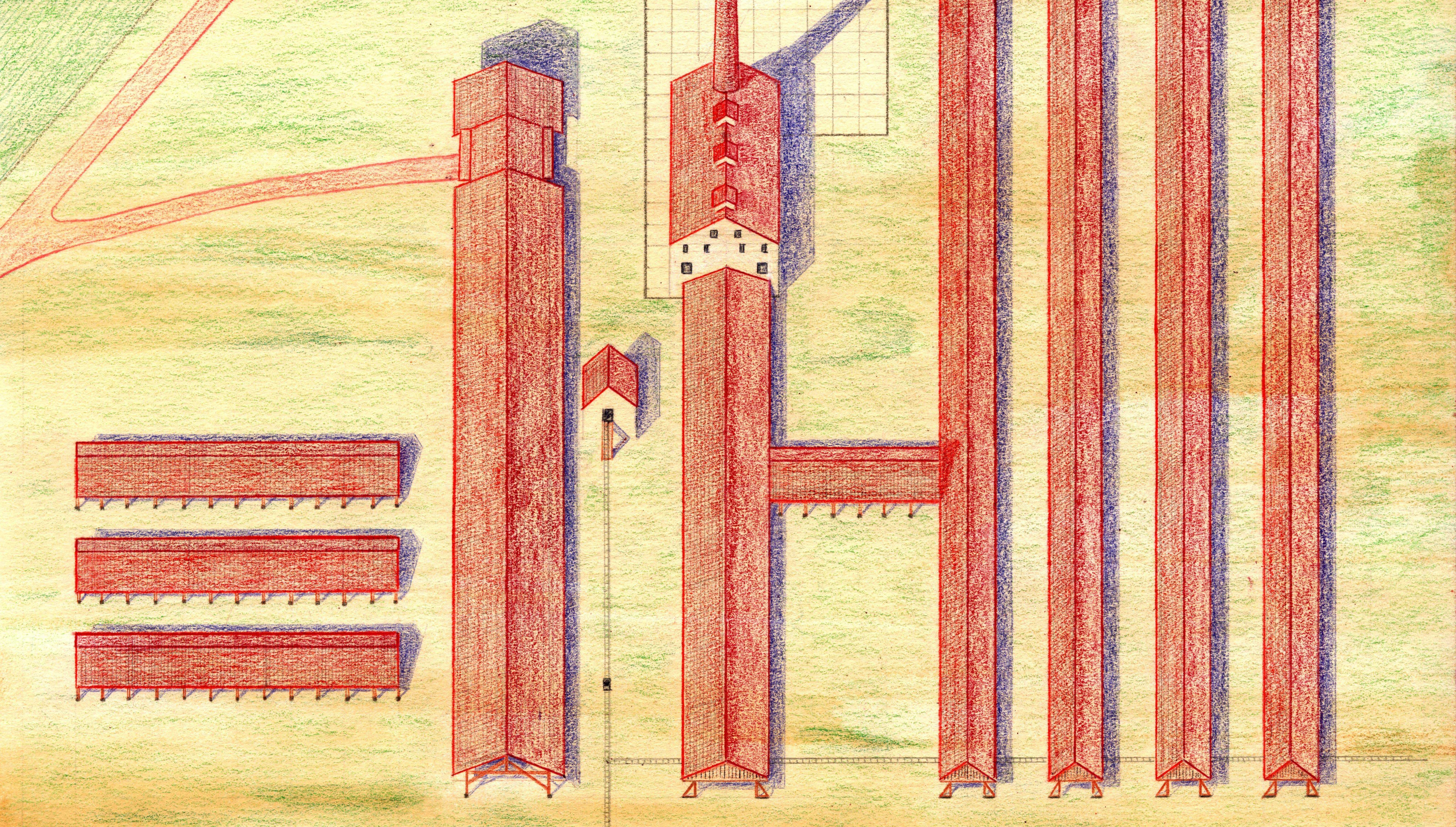
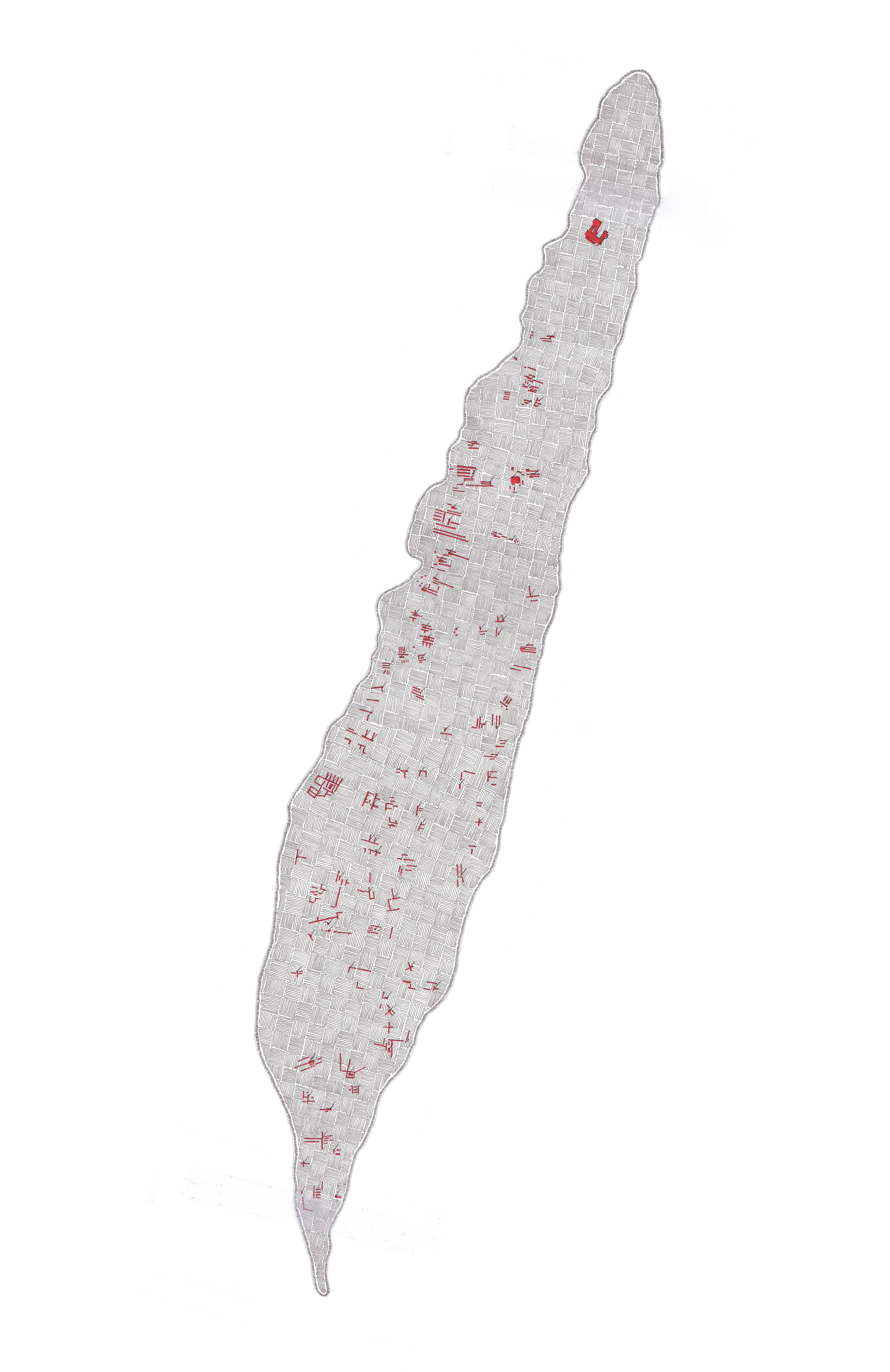
Die folgende Arbeit thematisiert die Effekte und Absichten im Lehmabbau zur Schaffung neuer Lebenswelten. Diesem Vorgang prädestinieren zehntausenden Jahren der Lehmbildung und davor Millionen von Jahrenn geologischer Prozesse, die zur Formung der heutigen Umwelten geführt haben. Solche Prozesse können im Laufe eines Menschenlebens nicht wahrgenommen werden, aber der menschliche Eingriff in die Natur hat eine radikale Veränderung von Landschaften innerhalb kürzester Zeit ermöglicht. Gernot und Hartmut Böhme erkennen, dass neuzeitliche Techniken der Wissenschaft, manipulativ und ausbeuterisch sind. Demzufolge wurde eine Entfremdung zwischen Mensch und Natur begünstigt.
„Alles, was auf diesem Boden sproßt, ist mit tausend Fäden an eine ganz bestimmte Weltkonstellation geknüpft, und es ist nur die Enge seiner Einsicht, wenn ein Mensch von einem fernen und weltenweiten Ding irgendwo da draußen glaubt, es sei ihm völlig fremd und habe seinem Schicksal gar nichts zu sagen.“
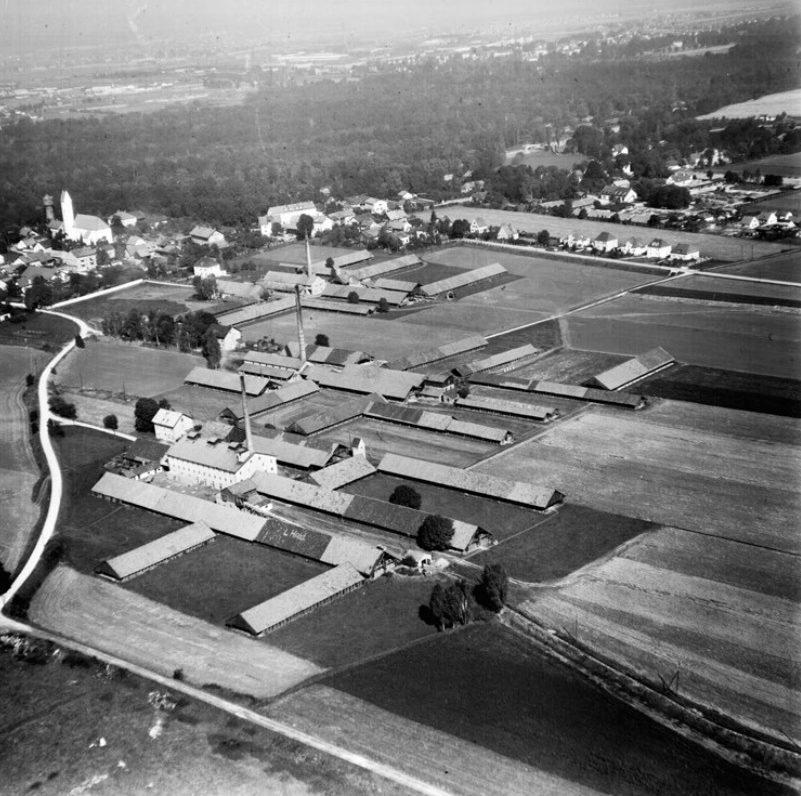
Mich beschäftigt die Auseinandersetzung mit dem Boden als Mittel zum Verständnis menschlichen Schaffens in der Architektur. Denn der Großteil unserer gebauten Welt entspringt aus einer Ressourcenverarbeitung, die ihren Ursprung als Erde bekennt. Darüber hinaus hängt die Existenz bestimmter Nicht-Architekturen unmittelbar vom Bodenvorkommen ab. Im Fall der Ziegelei, weisender Anblick eines Kamins, Trockenschuppen oder einer Grube unweigerlich auf die Nähe von Lehm hin. Es handelt sich allerdings um eine destruktive Beziehung, da die wechselseitige Auslöschung vorherbestimmt ist.


Im Raum des Münchner Ostens, das Gebiet auf welches ich mich im Folgenden beziehen mag, waren zeitweise über 100 Ziegeleien verteilt. Auf diesem Boden, sprosste und verging letztendlich eine riesige Industrie. Neben dem direkten Einfluss auf den Bau von Ziegelarchitektur in München, beschreibt die sogenannte Lehmzunge eine bedingte Vorstadt-Realität, geprägt von rauchenden Ziegeleien und bescheidenen Herbergshäusern. Von Menschen, die sich eine sich stetig veränderte Landschaft aneigneten und von einer eigenen Architektur, die nicht versuchte eine zu sein und trotzdem eine war. Heute ist dieses indirekte Erbe nahezu im Palimpsest der Stadt verschwunden. Die Idee eine alternative Realität herauszuarbeiten ergibt sich aus dem Bestreben, ein verlorenes Bewusstsein für das ansonsten ungreifbare Territorium zurückzugewinnen.
Anthropologische Befunde auf der Lehmzunge enthüllen frühgeschichtliche Geschehnisse. Nördlich von Englschalking verlief einst quer durch das Gebiet, auf der Strecke von Wels (Oberösterreich) bis Augsburg, ein Teil der römischen Salzstraße. Ein Beweis der ältesten Straße im Münchner Gebiet, dessen Bedeutung als Transportweg von Salz im Mittelalter wuchs. Ebenso aus der Römerzeit sind die Fundamente eines Römerbads ans Licht gekommen. Auch Spuren von Völkern wie den Bajuwaren lassen sich hier auch nachweisen, wie die Grabung einer altbajuwarischen Siedlung in Johanneskirchen zeigt. Die Bauern der mittelalterlichen Dörfern, deren Ursprung am Rande der Lehmzunge zurückzuführen ist, hatten damit begonnen die Landschaft am meisten zu prägen. Der nährstoffreiche Boden bot optimale Bedingungen für die Landwirtschaft.

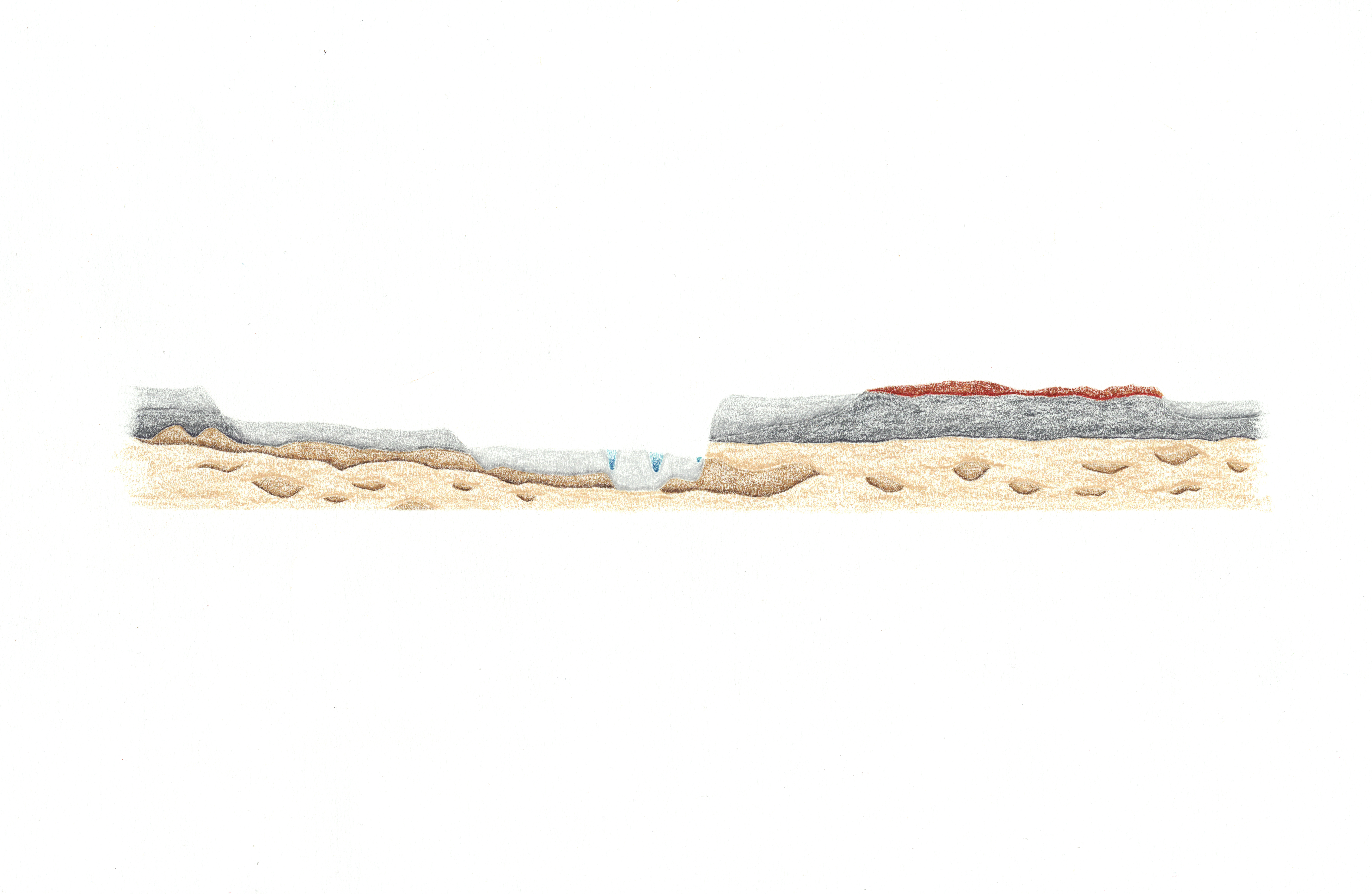

Ab dem 13. Jahrhundert durchlief München einen wirtschaftlichen Aufschwung, der zu einem Zuwachs der Bevölkerung und dichterer Stadtbebauung führte. Die aus Holz errichteten Gebäude fielen dadurch immer öfter verheerenden Bränden zum Opfer, so etwa in den Jahren 1327, 1418 und 1429. Ein Umstieg von Holz auf Ziegel erwies sich zur Vermeidung von Feuerausbrüchen unverzichtbar. Im Jahre 1342 wurde eine erste Bauordnung verabschiedet, die Ziegel als Material für die Dacheindeckung vorschrieb. Zusätzlich erhöhte sich zum Schutz der Stadt der Bedarf nach dem Bau von Befestigungsanlagen. Das Lehmvorkommen im Osten der Stadt sollte große Beihilfe leisten.
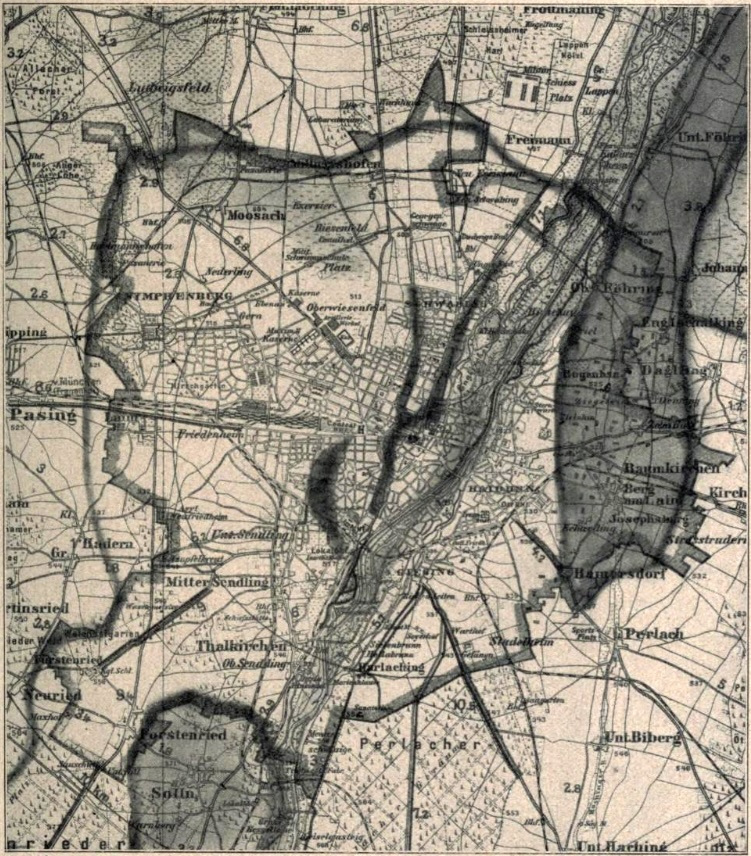
In Haidhausen hatte man folglich begonnen die ersten Gruben auszuschaufeln. Dies markierte den Beginn einer Wechselbeziehung zwischen dem heranwachsenden München und seinen benachbarten Vororten sowie der Landschaft. Bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts blieb jedoch das Lehmplateau weitgehend unbesiedelt.
„Die historisch gewordenen Grenzen von München decken sich gesetzmäßig mit der natürlichen Umgrenzungen seines Lebensbezirkes!“
Die Bauern waren bis Ende der Grundherrschaft 1848 nicht Eigentümer ihres Landes. Erst danach konnten sie frei entscheiden, ob sie Grund und Boden weiter bewirtschaften oder verkaufen wollten. In der Folge änderten sich die Bodenverhältnisse: Entweder kauften Ziegelunternehmer die Grundstücke auf, oder die Bauern stiegen aufgrund der höheren Einnahmen, vom Ackerbau auf das Ziegelgeschäft um. Von Ackerland zu Ziegelland zu Bauland. Der Weiterverkauf als billiges Bauland stand unmittelbar nach Ausschöpfung der Ressource bevor. Spekulative Arbeit war für die Gründung eines Ziegelgeschäftes vorausgesetzt, sodass sich das Geschäftsmodell nicht grundlegend änderte.
Die Expansion von München, die ständig einer dringenden Wohnungsnot antworten musste, sah sich daher begünstigt. Im 19. Jahrhundert verlagerte sich die Münchens Stadtgrenze ertmals von der linken auf die rechte Seite des Isarufers. Etablierte Vororte wie Haidhausen und Bogenhausen, die einem idyllischen Bild eines Dorfes mehr als einer Stadt entsprachen und gleichzeitig von einer steigenden Ziegelindustrie geprägt waren, begrüßten die Eingemeindung jeweils 1854 und 1892.
Aus dem erworbenen Land sind seitdem ganze Stadtteile, Dorfkolonien und Siedlungen hervorgekommen. Demnach bedingte der Ressourcenabbau die voranschreitende Versiegelung der Landschaft. Solange die Ziegeleien in Betrieb waren, konnten Ziegeln für den Bau lokaler Architektur eingesetzt werden. Sonst erlagen die Gruben einer Zuschüttung und die Ziegelwerke einem Abriss. Gebäude anderer Bauweisen, wie der Betonbau, die sich seit der Nachkriegszeit als wirtschaftlicher erwiesen, überbauten die freigesetzten Grundstücke weiter. In den 1960‘er Jahren endete schließlich die Ära der Ziegeleien endgültig.
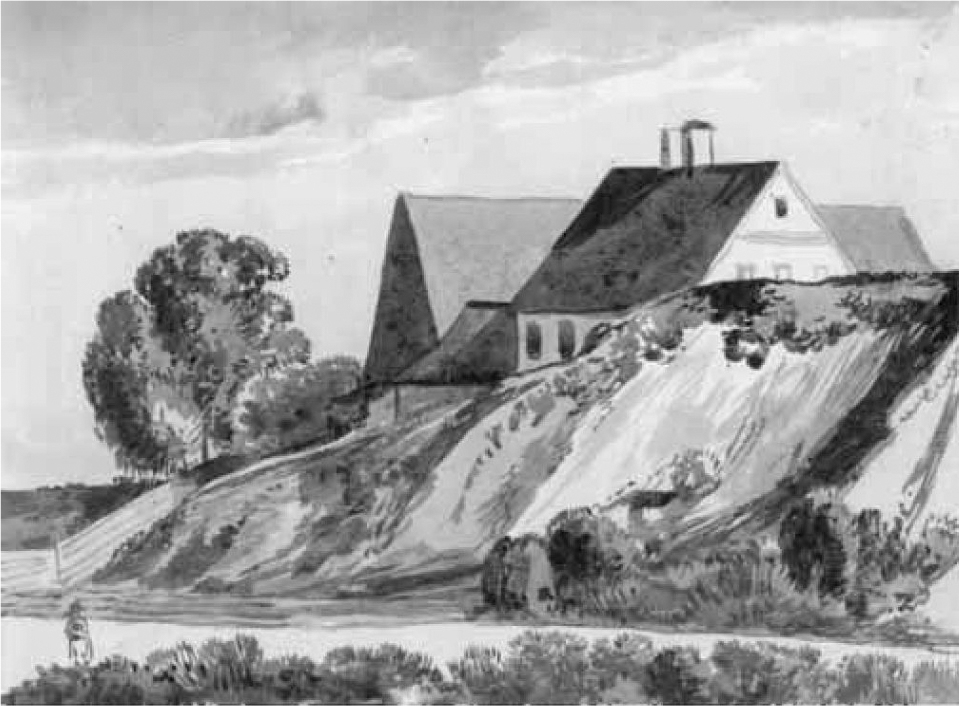

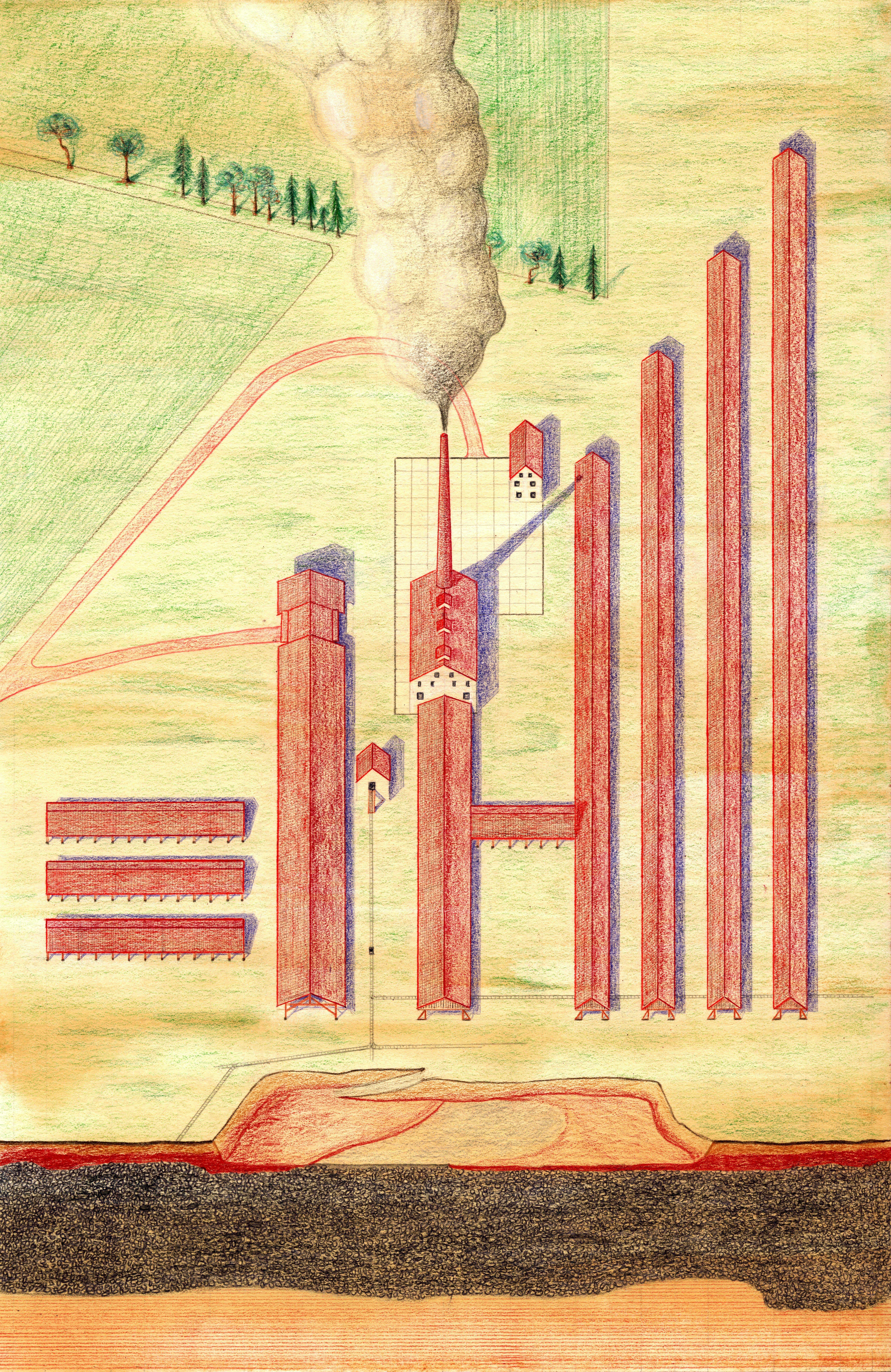
Fritz Höger über den Backsteinbau:
„Alles ist Struktur und nichts Textur, alles ist Konstruktion und Ornament zugleich, zugleich Zweckerfüllung und Schönheit. Die Schönheit liegt hier eben im Ding selbst; und dannn - in der großen Solidität und Unvergänglichkeit und Festigkeit liegt ja ein so starker, ewigkeitsgemahnender Ausdruck! .“
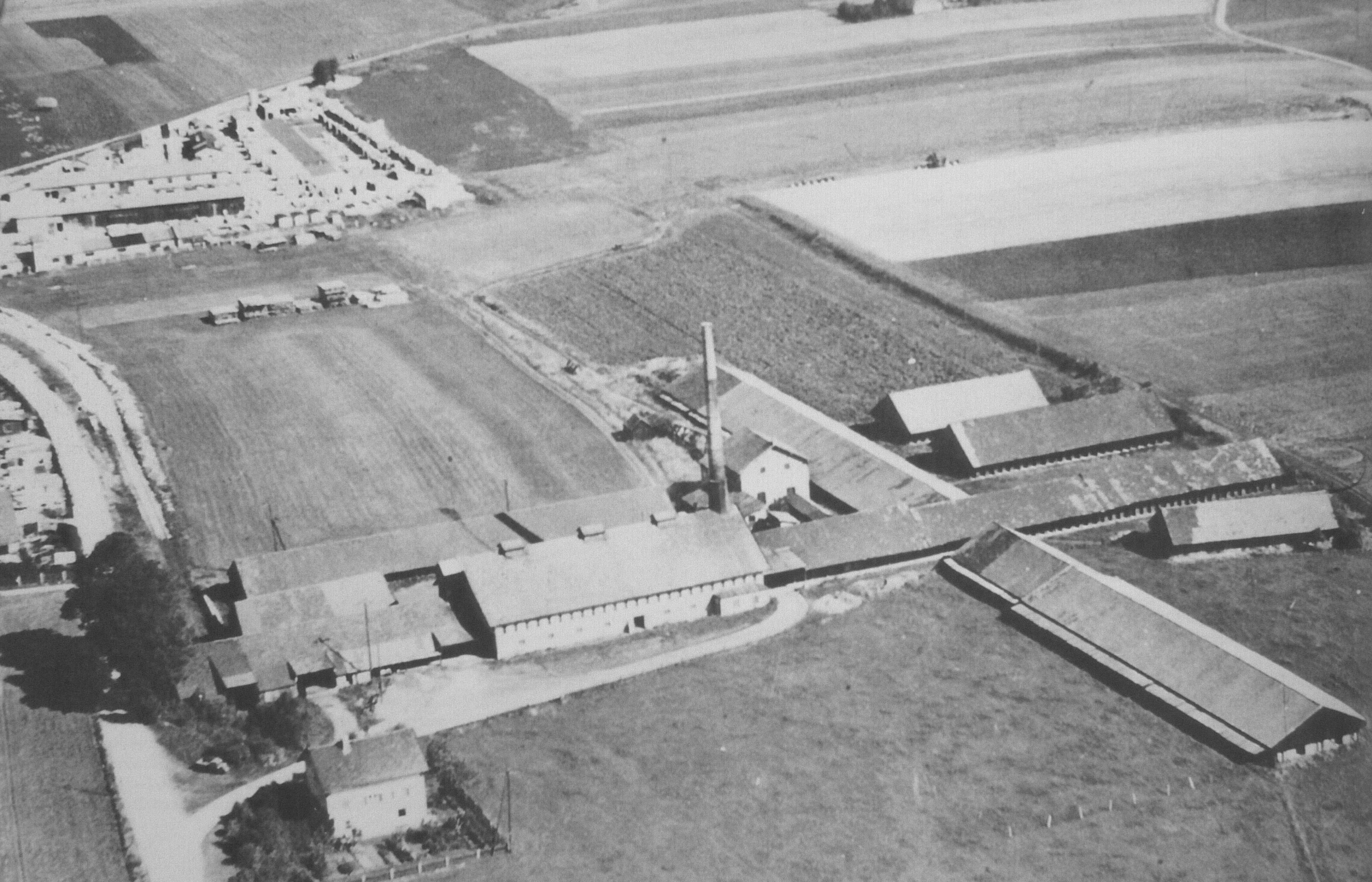
Der Ablauf einer Ziegelei ist im Wesentlichen klar. Eduardo Torroja beschreibt ihn folgendermaßen: „nach fleißiger Knetung, geschickter Formung und geduldiger Trocknung, (verwandelt sich) durch die Wärme des mühsam entzündeten Feuers (der Lehm) in Stein“.
Wie eine Ziegelei jedoch aufgebaut ist und welche genauen Methoden angewendet werden, hängt stark vom jeweiligen Zeitalter und der Verfügbarkeit von Ressourcen ab. Die Vielfältigkeit der Verfahren ist groß. Zudem handelt es sich beim Ziegel um ein Baumaterial, dessen Eigenschaften und Qualitäten ebenso variabel sind wie die nachfolgende Ausführung. Der Lehm wird aus seinem ruhenden Zustand im Boden gebrochen, wobei die entstehende Grube den Naturgewalten ausgesetzt bleibt. Für den geformten Lehm, auch Formlinge genannt, geht es traditionell zur natürlichen Trocknung hinüber. Um die Formlinge vor Niederschlag zu schützen, wird eine von einer Grundstruktur getragene Überdachung verwendet. Die Kraft des Windes wird durch strategische Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen und den Einsatz beweglicher Elemente zur Regulierung des Durchzugs unterstützt. Nach ausreichender Trocknung werden die einzelnen Steine in einem Ofen ausgelegt und mit entsprechendem Abstand zueinander gestapelt. Während des Brennvorganges sind die Gleichmäßigkeit und die Temperatur des Feuers entscheidend für die Qualität der Steine. Eine geschickte Handhabung des Feuers reduziert die Menge an Abgasen und den Energieverbrauch. So kann die erzeugte Wärme in einem Kreislauf teilweise weiter genutzt werden.
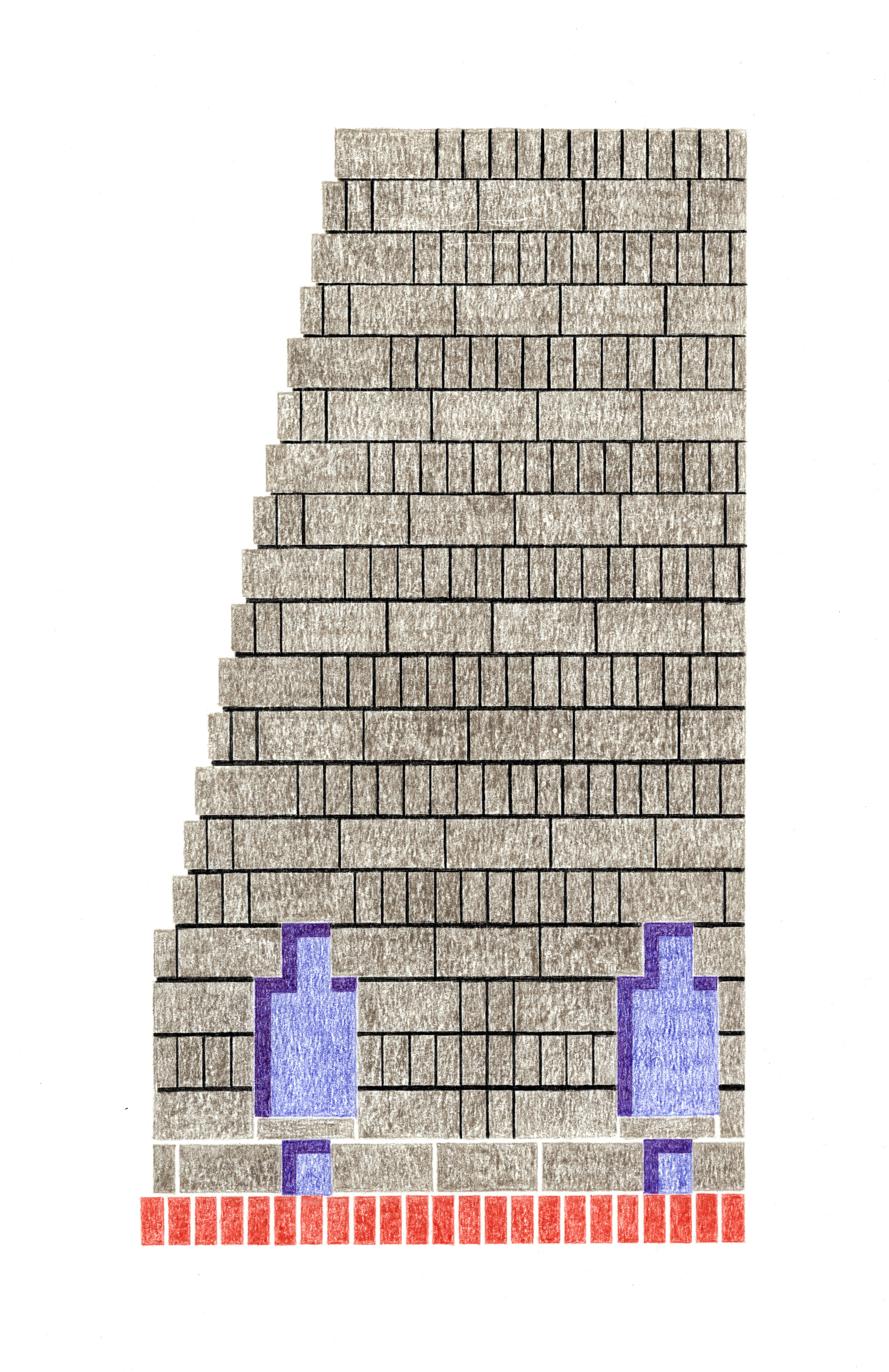

Gleichzeitig verändert sich die landschaftliche Umgebung drastisch. Das Aufrechterhalten der Welt der Ziegelherstellung unterliegt einer unausweichlichen Ausschöpfung. Während das Gefühl der Flüchtigkeit das Materielle umhüllt, entfremden sich die Strukturen immer mehr von ihrem ursprünglichen Dasein.


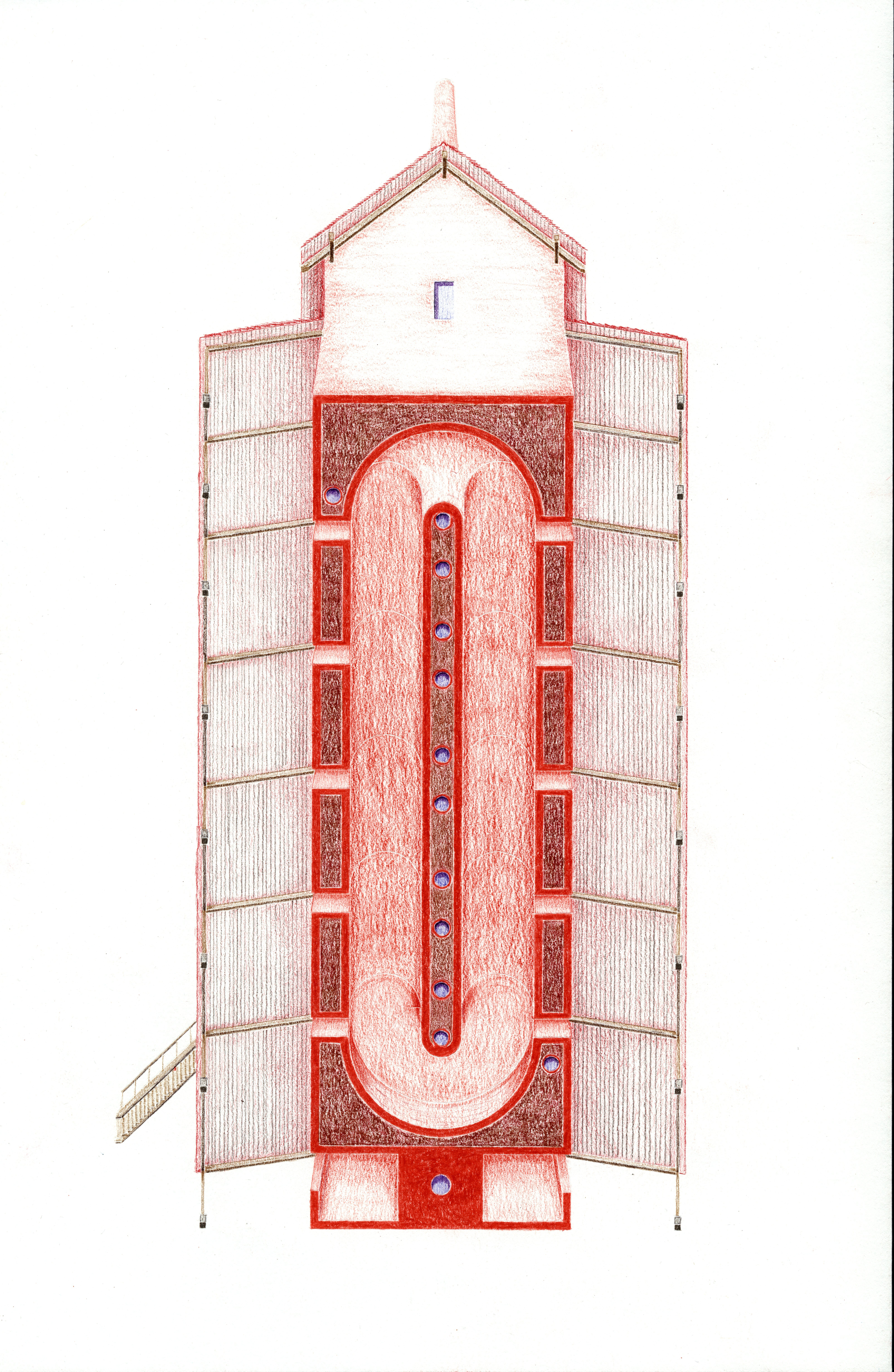
Die Herberge im Münchner Osten bezeichnet ein Haus mit entsprechendem Grundstück, das mehrfachen Raumaufteilung und Anbauung unterworfen war. Die Bewohner besaßen Nutzeigentum von den besessenen Raumeinheiten. Der Eigentumsanteil konnte sich über ein ganzes Stockwerk erstrecken oder auch nur ein einzelnes Zimmer umfassen. Nicht das Haus selbst, sondern jede Einheit kannte man als Herberge oder als Gemach.
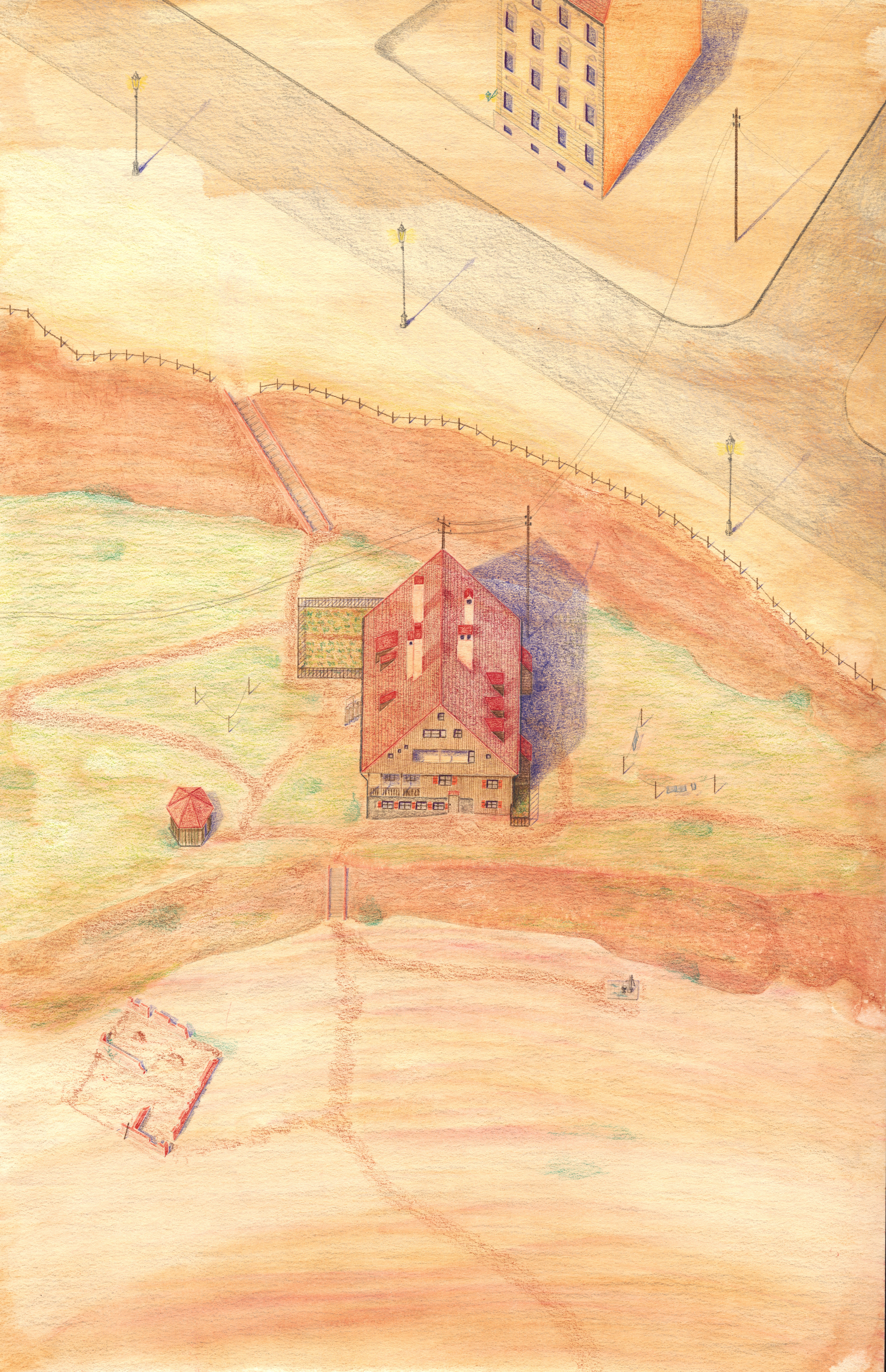
So entstanden Kleinhäuser, die keinem festen Gebäudetyp folgten, sondern das Resultat von den Vorstellungen jedes Eigentümers kristallisierten. Es wurde nur auf das Nötigste geachtet, denn die Menschen die hier behausten überwiegend einkommensschwache Handwerker und Tagelöhner waren. Lagerschuppen kompensierten die oft fehlenden Kellergeschosse, was zu einer dichteren Bebauung des Flurstückes führte. Zusätzlich verfügte jedes Gemach über einen eigenen Hauseingang, sodass häufig überdachte Außentreppen angebracht werden mussten. Das Konzept des Altmünchner Herbergsrecht gilt als Vorreiter der modernen Eigentumswohnung. Der besonders malerischer Charakter der Herbergsvierteln ergab sich teilweise aus der Einfachheit der Bauweise. Eine Anlehnung an die traditionelle alpine Architektur ist wiederzuerkennen. Die Beschränkung der Herbergsvierteln auf ehemaligen Lehm-, Kies- und Sandgruben und der hochwassergefährdeten Au, setzten weder die Häuser noch ihren Bewohnern in ein positives Licht vor den erbgesessenen Münchner Bürgern. Die Menschen der Au und Haidhausen galten als „Fremdlinge“. Bereits der Höhenunterschied zwischen Straßenniveau und Grube führte dazu, dass auf das ärmere Volk herabgesehen wurde - eine Haltung, die sich in Überheblichkeit und Skepsis widerspiegelte. Zudem waren in den engen Nachbarschaften aufgrund schlechter hygienischen Verhältnissen oft Seuchen verbreitet. Für das Stadtamt lag es daher nahe, die Herbergsviertel abzureißen und den Baugrund für neue Mietshäuser zu nutzen. Dennoch handelte es sich bei diesen Vierteln um eine an die Umgebung angepasste Lebenswelt, die letzlich dem Wachstum der Stadt weichen musste.



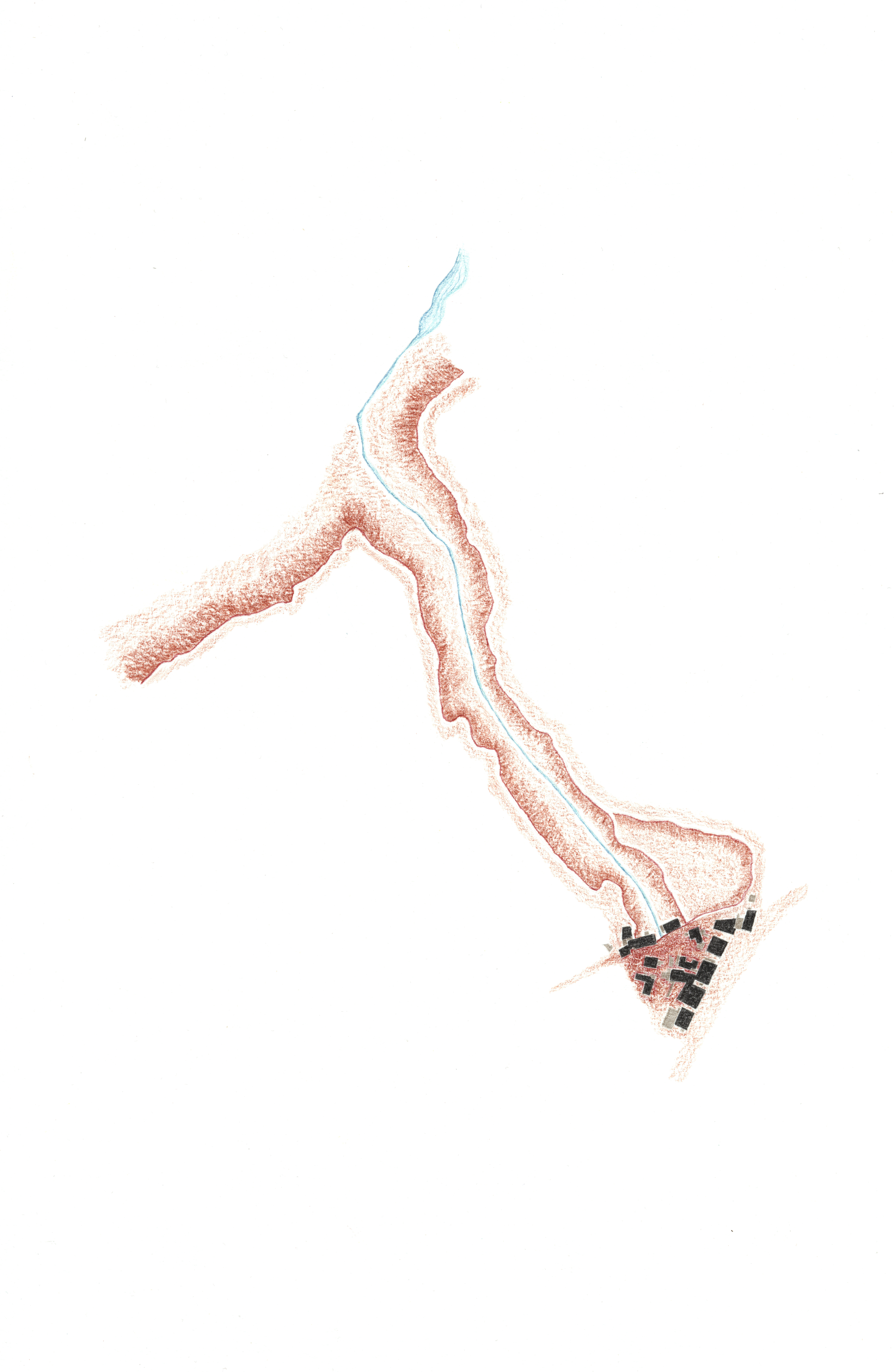


„Unser Interesse an der unsichtbaren Welt liegt darin, für sie in der sichtbaren Welt eine Form zu finden, d.h. das trügerisch vertraute, sichtbare, äußere Erscheinungsbild aufzubrechen, zu zerlegen, zu atomisieren, bevor wir erneut damit umgehen können.“
Die Ziegelei gewinnt an Beständigkeit, indem sie zum Kern des öffentlichen Lebens aufstrebender Gemeinden wird. Die Gruben verwirklichen neuen Lebensraum. Sie werden nicht zugeschüttet, sondern setzen die Gestaltung des Raumes voraus. Somit terrassiert sich der Boden auf und ab und bestimmt eine ausbeuterische aber ehrliche Topographie. Die hierarchischen Ebenen aus Höhen und Tiefen sind für alle zugänglich. Höher gelegene Flächen werden für landwirtschaftliche Nutzung und Gärtnerei verwendet. Sie werden von der Nachbarschaft gepflegt und gemeinschaftlich benutzt. Aus der klaren Längsausrichtung der Ziegelei entstehen, an der älteren Bausubstanz der Ringöfen und Trockenstadln angeknüpft, lange Häuser. Sie sind mit Holzstruktur, Überdachung, Erschließung, gemauerte Sockelebene und leichte äußere Hülle konzipiert - eine direkte Ableitung aus der Bauweise der Ziegeleikonstruktion.
Die Idee dahinter ist die Erkenntnis, dass die Bedürfnisse der Menschen eine Übertragung der elementaren Logik der Ziegelherstellung sind und somit der architektonische Ausdruck dies aufgreifen kann. Orthogonal zu den Längsstrukturen erstrecken sich Brücken und verbinden diese miteinander. Der Innenausbau bleibt den Vorstellungen der Bewohner überlassen, wobei langlebige und gemeinschaftlich orientierte Konzepte besseren Einklang finden. Das Zusammenwachsen am Ort und das Verweben aller Lebenssituationen wird gestrebt. In diesem Zusammenhang wird das Herbergsrecht weitergeführt: Die einst einzeln stehenden Herbergshäuser vermehrten sich entlang der Straßen, bis sie auf die benachbarten Ziegeleigrundstücke stießen und sich anfänglich um die Grube herum ansiedelten. Im Laufe der Zeit hat sich eine Symbiose beider Architekturen herausentwickelt. Eine Zukunft wird erblickt, die zwar fern vom Lehmabbau liegt, aber dennoch eine enge Verbindung zum Boden und dem Bestand wahrt.
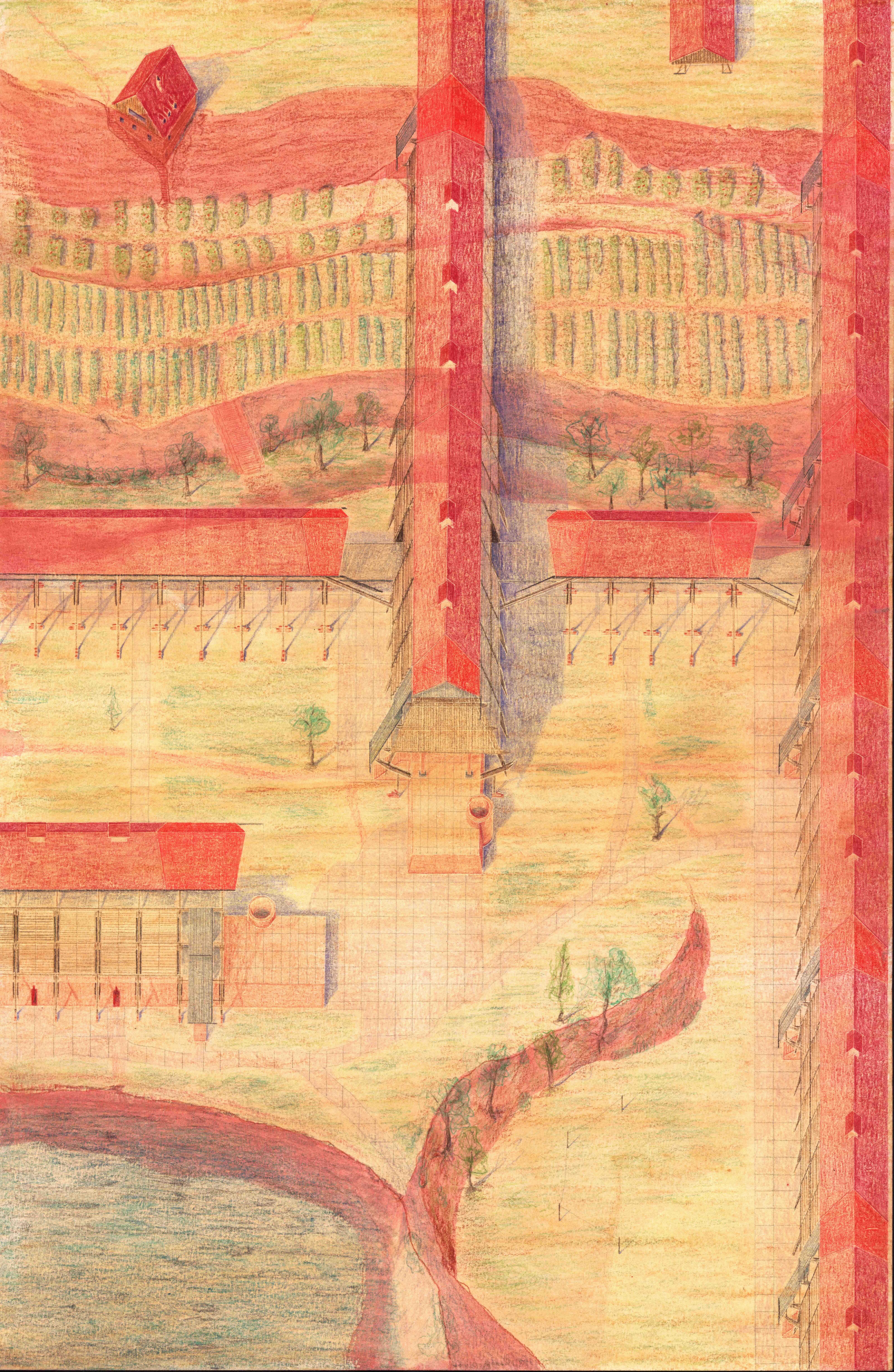
Project by: Stefan Nikolas Schenkel Naranjo
Supervisor Alex Lehnerer